BZ-Serie Integration
Ein Suchtforscher erklärt die verbreitete Alkoholabhängigkeit bei Flüchtlingen
Kriegsflüchtlinge haben oft Unvorstellbares erlebt; um die Schrecken zu betäuben, verfallen manche dem Alkohol. Das deutsche Gesundheitssystem sei darauf nur unzureichend vorbereitet, meint der Suchtforscher Ingo Schäfer.
BZ: Worauf führen Sie das zurück?
Schäfer: Flüchtlinge sind aus vielen Gründen besonders suchtgefährdet. Viele haben in ihrer Heimat, im Krieg oder auf der Flucht schreckliche Dinge erlebt, die sie verarbeiten müssen. Hinzu kommt die Ungewissheit, wie es mit ihrem Leben in Deutschland weitergeht, oft auch Perspektivlosigkeit und Langeweile. Da kommen ganz unterschiedliche Faktoren zusammen. Das Problem ist, dass unser Hilfssystem auf diese Zielgruppe nicht ausreichend eingestellt ist.
BZ: Wie viele Geflüchtete leiden unter einer Sucht?
Schäfer: Genaue Zahlen gibt es noch nicht. Wir bauen aber gerade eine nationale Plattform auf und haben ein Forschungsvorhaben begonnen, damit wir einen besseren Überblick bekommen.
BZ: Ab wann gilt jemand überhaupt als alkoholabhängig?
Schäfer: Es gibt sechs Kriterien, von denen mindestens drei innerhalb eines Jahres erfüllt sein müssen: Der starke Wunsch Alkohol zu trinken, ein Kontrollverlust und die Entwicklung einer Toleranz gegenüber Alkohol, körperliche Entzugssyndrome, Vernachlässigung von Hobbys und Interessen, anhaltender Konsum trotz schädlicher Wirkung. Bei Frauen gilt alles, was zwölf Gramm Alkohol am Tag überschreitet, als riskanter Konsum; bei Männern ist es etwa die doppelte Menge. Aber auch da gibt es große individuelle Unterschiede.
BZ: Viele Geflüchtete kommen aus arabisch geprägten Ländern, in denen Alkohol tabu ist. Müsste das nicht eine abschreckende Wirkung haben?
Schäfer: In Deutschland lernen Jugendliche sehr früh, welche Gefahren mit einem übermäßigen Konsum verbunden sind. Bei Flüchtlingen, die aus Abstinenzländern kommen, ist das anders. Manche schützt ihre Religion, natürlich. Aber die Versuchung ist groß, wenn Migranten auf eine Kultur treffen, in der Alkohol ständig in Griffnähe verfügbar ist. Das hat Folgen.
BZ: Vor welche Herausforderungen stellt das unser Gesundheitssystem?
Schäfer: Je nach kulturellem Hintergrund haben die Menschen eine ganz andere Einstellung zu Hilfsangeboten. Die Hemmschwelle, einen Arzt aufzusuchen, ist viel größer, oft auch die Skepsis. Weil Alkohol in vielen muslimischen Ländern tabuisiert ist, wird eine Sucht eher als Charakterschwäche ausgelegt – und nicht als Krankheit. Da gibt es eine viel größere Scham, Hilfe anzunehmen. Auch die Sprachbarriere stellt eine große Herausforderung dar.
BZ: Gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern?
Schäfer: Bei Männern ist es oft der Alkohol, der zum Problem wird. Frauen greifen dagegen eher zu Beruhigungs- und Schmerzmitteln, um Trauma-Folgen und -Störungen zu betäuben. Manche haben schon auf der Flucht eine Abhängigkeit entwickelt, um mit dem Erlebten irgendwie klarzukommen.
BZ: Wie kann man diese Menschen erreichen?
Schäfer: Sowohl die Prävention als auch die Behandlung müssen besser werden. Wenn die Leute nicht von selbst in die Praxis kommen, sollten wir über andere Lösungen nachdenken, zum Beispiel über Peer-basierte Konzepte. Der erste Kontakt zum Hilfssystem könnte über Leute laufen, die selbst aus den Communities stammen und einen Migrationshintergrund haben. Noch wissen wir aber nicht, wie wirksam dieser Ansatz ist. Das muss untersucht werden.
BZ: Was halten Sie von Aufklärungsvideos in arabischer Sprache, wie sie zum Beispiel die Hessische Landesstelle für Suchtfragen auf Youtube stellt?
Schäfer: Generell begrüße ich solche Initiativen, weil sie eine Intervention auf dem Medium bieten, mit dem die Leute sowieso vertraut sind: nämlich mit dem Smartphone. Aber auch da müssen wir evaluieren, wie groß die Wirksamkeit ist.
BZ: In manchen Wohnheimen ist Alkohol komplett verboten. Wie sinnvoll ist das?
Schäfer: Prinzipiell hat eine Beschränkung einen präventiven Effekt. Restriktionen allein helfen aber nicht, wenn keine Aufklärung dazukommt. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Grenze zur Diskriminierung nicht überschreiten.
BZ: Welche Hilfsangebote gibt es aktuell?
Schäfer: Das ist regional sehr unterschiedlich. Vielerorts wird schon sehr gute Arbeit geleistet. In Berlin wurde gerade ein online-basiertes Pilotprojekt gestartet, bei dem Informationen zur Abhängigkeit zur Verfügung gestellt werden. Was noch fehlt, ist eine übergeordnete bundesweite Koordinierung, damit wir uns ein Gesamtbild der Hilfsangebote machen können.
BZ: Wer zahlt die Kosten für eine Suchtbehandlung bei Asylbewerbern?
Schäfer: Das ist aktuell noch ein großes Problem. Das Asylbewerber-Leistungsgesetz kommt nur für akute Notfallbehandlungen auf. Wer die längerfristige Suchtbehandlung oder die Dolmetscher bezahlt, ist noch immer nicht geklärt. Da bleiben wir als Klinik im Zweifel auf den Kosten sitzen.









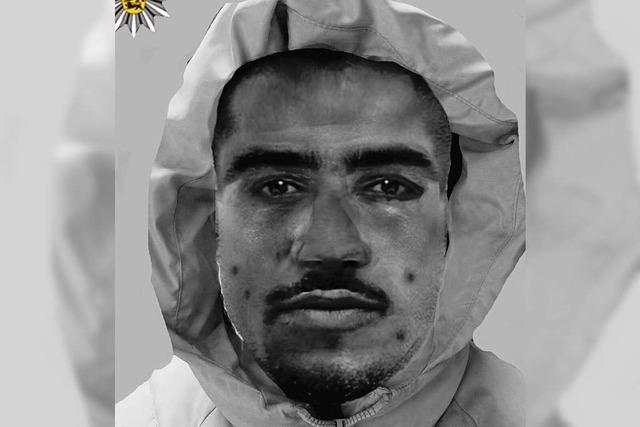

Kommentare
Liebe Leserinnen und Leser,
leider können Artikel, die älter als sechs Monate sind, nicht mehr kommentiert werden.
Die Kommentarfunktion dieses Artikels ist geschlossen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Viele Grüße von Ihrer BZ