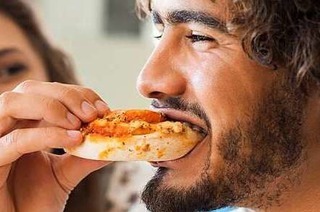Markgräfler Museum in Müllheim
Barbara Siebecks Polaroid-Fotos: Kalkuliert und komponiert
Es gab eine Zeit – und sie ist noch gar nicht so lange her – da war der Fotoapparat eine Blackbox im wahrsten Sinne des Wortes. Was der Fotograf beim Druck auf den Auslöser im Bruchteil einer Sekunde dem Strom der Zeit entriss, das landete im Innern des Geräts, gebannt auf einen mit Chemikalien beschichteten Streifen. Sichtbare Ergebnisse gab es in der Regel erst Stunden, oft Tage, manchmal sogar Wochen später zu sehen. Wer dieses Warten verkürzen wollte, hatte eigentlich nur eine Möglichkeit: Er griff zu einer Sofortbildkamera, deren Entwicklung vor allem von einem Unternehmen so stark geprägt wurde, das dessen Name zum Gattungsnamen für die gesamte Technik wurde: Polaroid.
Wer ernsthaft Fotografie betrieb in jenen Tagen, für den war eine Polaroid-Kamera gemeinhin bestenfalls ein Spielzeug. Bildfehler, mangelnde Schärfe, merkwürdige Farben: Wenngleich die Polaroids im Laufe der Jahrzehnte – die ersten Kameras und Filme dieser Art wurden in den 1940er-Jahren entwickelt – eine gewisse qualitative Entwicklung durchliefen, so blieben sie doch eher eine Randerscheinung, zumal vor allem die Filme recht teuer waren.
Und doch hatten die Polaroids auch immer – und bis heute – ihre Fans, und manche von ihnen kultivierten mit diesen Kameras auf eine ganz eigene Art und Weise die Kunst des Schnappschusses. Wie Barbara Siebeck, die Frau des Gastrokritikers und Journalisten Wolfram Siebeck. Barbara Siebeck begleitete ihren berühmten Gatten auf seinen Reisen und den zahlreichen Restaurantbesuchen. Im Gepäck immer dabei: eine Polaroid-Kamera, die auch hin und wieder in der heimischen Küche zum Einsatz kam, wenn der gestrenge Hüter wahrer Ess- und Trinkkultur selbst Hand anlegte.
"Weil sie so praktisch ist", antwortet Barbara Siebeck schlicht auf die Frage, warum bei ihr bis heute ausschließlich eine Sofortbildkamera zum Einsatz kommt. Irgendwann, erzählt sie mit einem feinem Hauch von Ironie in der Stimme, habe man bei der Zeit gemerkt, dass sie ja auch immer dabei war mit ihrem Apparat, wenn ihr Mann auf Tour ging. Zur Illustration seiner Kolumnen wurden ihre Bilder verwendet – "so sparte sich die Zeitung den Einsatz eines eigenen Fotografen".
Wieviel in und hinter ihren Bildern steckt, ob sie womöglich sogar Kunst sind – das überlässt Barbara Siebeck gerne den Betrachtern. Die können diesen Fragen nun in einer Ausstellung im Markgräfler Museum in Müllheim nachgehen, die es in dieser Art noch nie gegeben hat. Es ist durchaus ein kleiner Coup – einmal mehr beweist dieses kleine, aber feine Haus, dass auch Regionalmuseen mit Kreativität und ein wenig Mut und Glück zu attraktiven Anziehungspunkten für Kulturinteressierte werden können.
Zu verdanken ist die Siebeck-Polaroid-Ausstellung vor allem dem Freiburger Journalisten Christoph Wirtz, der zusammen mit dem Winzer Hermann Dörflinger auch der kreative Kopf der Gutedel-Gesellschaft ist, und zudem ein guter Bekannter der Siebecks. Zusammen mit der Fotografin und dem Team des Markgräfler Museums um den Müllheimer Kulturdezernenten Jan Merk hat er dafür gesorgt, dass die Ausstellung von Siebecks Bildern zu einem erhellenden und vor allem kurzweiligen Genuss wird.
Denn die eher kleinformatigen Polaroids zu präsentieren ist, gelinde gesagt, eine größere Herausforderung. Gemeistert wurde sie unter anderem durch eine kluge Zusammenstellung, die thematische Bögen über die Einzelbilder hinaus erlaubt. Sehr nett auch der Einfall, bei einigen wenigen ausgewählten Fotos einen Farbton herauszugreifen und mit diesem einen Rahmen um das kleine Bild zu pinseln. Hinzu kommen hier und da sparsam, aber wirkungsvoll eingesetzte Accessoires, wie ein Reiseführer oder ein Hut und ein Tuch von Wolfram Siebeck, die auch auf dem Cover des Zeit-Magazins zu sehen sind, das zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 2008 erschien.
Wer aufmerksam hinschaut, erkennt aber vor allem eines: Den wachen und klugen Blick einer Frau, der es in ganz vielen Fällen gelingt, jene subtile Grenze zu überschreiten, die einen banalen Schnappschuss, der maximal subjektive Bedeutung entfaltet, von einem Bild mit Aussagekraft trennt. Ein Bild, das einen für Momente innehalten, näher hinschauen, nachdenken, schmunzeln lässt. Bei Barbara Siebeck ganz oft vor allem Letzteres: So ist der Bordrestaurant-Waggon der Deutschen Bahn, vor dem ein Mülleimer mit der Aufschrift "Restmüll" (in gleicher Farbe und Typographie) in den Blick genommen wird, ein Beispiel für jenes Talent, innerhalb weniger Augenblicke ein Bild kalkulieren und auch komponieren zu können.
Barbara Siebeck, die in erster Ehe mit dem Fotografen Will McBride verheiratet war, verfügt ganz offensichtlich über diese Gabe. Und ist damit – unbeabsichtigt – zur Vorreiterin eines Mega-Trends geworden, der in Zeiten von Facebook, Instagram und Twitter Heerscharen von Foto-Enthusiasten auf aller Welt erfasst hat: die visuelle Protokollierung des Alltags, die bei aller Spontanität immer auch eine Inszenierung ist.
– Markgräfler Museum, Müllheim. Bis 24. Mai, Dienstag bis Sonntag, 14 – 18 Uhr. von Alexander Huber
Wer ernsthaft Fotografie betrieb in jenen Tagen, für den war eine Polaroid-Kamera gemeinhin bestenfalls ein Spielzeug. Bildfehler, mangelnde Schärfe, merkwürdige Farben: Wenngleich die Polaroids im Laufe der Jahrzehnte – die ersten Kameras und Filme dieser Art wurden in den 1940er-Jahren entwickelt – eine gewisse qualitative Entwicklung durchliefen, so blieben sie doch eher eine Randerscheinung, zumal vor allem die Filme recht teuer waren.
Und doch hatten die Polaroids auch immer – und bis heute – ihre Fans, und manche von ihnen kultivierten mit diesen Kameras auf eine ganz eigene Art und Weise die Kunst des Schnappschusses. Wie Barbara Siebeck, die Frau des Gastrokritikers und Journalisten Wolfram Siebeck. Barbara Siebeck begleitete ihren berühmten Gatten auf seinen Reisen und den zahlreichen Restaurantbesuchen. Im Gepäck immer dabei: eine Polaroid-Kamera, die auch hin und wieder in der heimischen Küche zum Einsatz kam, wenn der gestrenge Hüter wahrer Ess- und Trinkkultur selbst Hand anlegte.
"Weil sie so praktisch ist", antwortet Barbara Siebeck schlicht auf die Frage, warum bei ihr bis heute ausschließlich eine Sofortbildkamera zum Einsatz kommt. Irgendwann, erzählt sie mit einem feinem Hauch von Ironie in der Stimme, habe man bei der Zeit gemerkt, dass sie ja auch immer dabei war mit ihrem Apparat, wenn ihr Mann auf Tour ging. Zur Illustration seiner Kolumnen wurden ihre Bilder verwendet – "so sparte sich die Zeitung den Einsatz eines eigenen Fotografen".
Wieviel in und hinter ihren Bildern steckt, ob sie womöglich sogar Kunst sind – das überlässt Barbara Siebeck gerne den Betrachtern. Die können diesen Fragen nun in einer Ausstellung im Markgräfler Museum in Müllheim nachgehen, die es in dieser Art noch nie gegeben hat. Es ist durchaus ein kleiner Coup – einmal mehr beweist dieses kleine, aber feine Haus, dass auch Regionalmuseen mit Kreativität und ein wenig Mut und Glück zu attraktiven Anziehungspunkten für Kulturinteressierte werden können.
Zu verdanken ist die Siebeck-Polaroid-Ausstellung vor allem dem Freiburger Journalisten Christoph Wirtz, der zusammen mit dem Winzer Hermann Dörflinger auch der kreative Kopf der Gutedel-Gesellschaft ist, und zudem ein guter Bekannter der Siebecks. Zusammen mit der Fotografin und dem Team des Markgräfler Museums um den Müllheimer Kulturdezernenten Jan Merk hat er dafür gesorgt, dass die Ausstellung von Siebecks Bildern zu einem erhellenden und vor allem kurzweiligen Genuss wird.
Denn die eher kleinformatigen Polaroids zu präsentieren ist, gelinde gesagt, eine größere Herausforderung. Gemeistert wurde sie unter anderem durch eine kluge Zusammenstellung, die thematische Bögen über die Einzelbilder hinaus erlaubt. Sehr nett auch der Einfall, bei einigen wenigen ausgewählten Fotos einen Farbton herauszugreifen und mit diesem einen Rahmen um das kleine Bild zu pinseln. Hinzu kommen hier und da sparsam, aber wirkungsvoll eingesetzte Accessoires, wie ein Reiseführer oder ein Hut und ein Tuch von Wolfram Siebeck, die auch auf dem Cover des Zeit-Magazins zu sehen sind, das zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 2008 erschien.
Wer aufmerksam hinschaut, erkennt aber vor allem eines: Den wachen und klugen Blick einer Frau, der es in ganz vielen Fällen gelingt, jene subtile Grenze zu überschreiten, die einen banalen Schnappschuss, der maximal subjektive Bedeutung entfaltet, von einem Bild mit Aussagekraft trennt. Ein Bild, das einen für Momente innehalten, näher hinschauen, nachdenken, schmunzeln lässt. Bei Barbara Siebeck ganz oft vor allem Letzteres: So ist der Bordrestaurant-Waggon der Deutschen Bahn, vor dem ein Mülleimer mit der Aufschrift "Restmüll" (in gleicher Farbe und Typographie) in den Blick genommen wird, ein Beispiel für jenes Talent, innerhalb weniger Augenblicke ein Bild kalkulieren und auch komponieren zu können.
Barbara Siebeck, die in erster Ehe mit dem Fotografen Will McBride verheiratet war, verfügt ganz offensichtlich über diese Gabe. Und ist damit – unbeabsichtigt – zur Vorreiterin eines Mega-Trends geworden, der in Zeiten von Facebook, Instagram und Twitter Heerscharen von Foto-Enthusiasten auf aller Welt erfasst hat: die visuelle Protokollierung des Alltags, die bei aller Spontanität immer auch eine Inszenierung ist.
– Markgräfler Museum, Müllheim. Bis 24. Mai, Dienstag bis Sonntag, 14 – 18 Uhr. von Alexander Huber
am
Sa, 11. April 2015