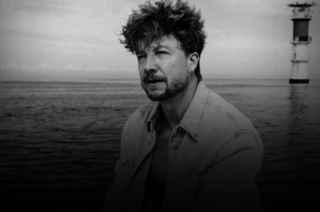Duftnoten
Basler Tinguely Museum widmet sich dem Riechen
Die Welt ist (auch) Duft – mal betörend und lockend, mal stinkend und abstoßend. Nicht zuletzt im Zwischenmenschlichen, Emotionalen, ist der Geruch ein Schlüsselfaktor – bis zum Sich-nicht-Riechen-Können. Im Alltag mischt das Organ fast überall vorne mit, in einer Hierarchie der Sinne steht dieser niedrigste, tierischste Sinn gleichwohl weit hinten. Dennoch gewinnt er in der hohen Kunst zunehmend an Bedeutung: Das verdeutlicht "Belle Haleine – Der Duft der Kunst", die neue und erste Ausstellung des Basler Tinguely Museums in einer Serie zur Rolle der Sinne in der Kunst, facetten- und erlebnisreich.
Schon beim Betreten des Gebäudes ziehen Aromen in die Nase, die an orientalische Gewürzbasare erinnern. "Ein Ausstellungsexperiment" nennen Museumsdirektor Roland Wetzel und Kuratorin Annja Müller-Alsbach die Schau denn auch, ein Experiment, das anknüpft an die Öffnung des Kunstbegriffs seit den 60er Jahren, in der Linie Alltag thematisiert und das vor allem auf Basis neuerer Arbeiten der letzten 20 Jahre. In einigen Fällen sind die gar in separaten, eigens im Museum aufgestellten Boxen installiert – kleine Laboratorien zur Geruchsforschung, in denen das Museum sein Pfund, das von seinem Ahnherren Tinguely mitinitiierte Prinzip interaktiver, partizipativer Kunst gut ausspielen kann – nicht zuletzt im Duftkino zu dessen Film "Study for an End of the World No 2".
Die in Berlin lebende norwegische Künstlerin, Chemikerin und Geruchsforscherin Sissel Tolaas, die im Vorjahr für das Militärhistorische Museum Dresden den Geruch von Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs rekonstruierte, konfrontiert da in einem dieser "White Cubes" mit dem Angstschweiß von elf Männern und weckt damit Impulse zwischen Neugier und Davonlaufen. Die Installation "The Fear of Smell – the Smell of Fear" entstand im Auftrag der amerikanischen Denkfabrik MIT während der Präsidentschaft von Georg Bush junior als Reaktion auf die kollektive Paranoia nach den Terroranschlägen in New York 2001. Sie basiert auf einer Studie, die den Schweiß von 21 Phobikern erfasste, dessen Duftmoleküle analysierte, synthetisierte und aufwändig mikroinkapsulierte, so dass Wände damit präpariert werden können. Die unterschiedlich getönten Streifen materialisieren nun nicht nur Individuen allein im Geruch, in deren Erleben offenbart sich auch der gesellschaftliche Umgang der Betrachter mit diesen Gerüchen.
Überhaupt ist das Einfangen, Materialisieren und Festhalten des flüchtigen Phänomens Duft und daran anknüpfende Assoziationen ein roter Faden, der sich durchzieht: Da hat die Schweizerin Anna-Sabina Zürrer für die Arbeit "Wald" einen Kubikmeter Nadelwald destilliert und eine Essenz gewonnen, die aus Glasfläschchen mit Blick auf den Rhein und die Basler Stadtautobahn im Museum versprüht werden darf und ein Aroma zwischen Saunaaufguss und Waldspaziergang verströmt. Oder "Concrete 2,3 g", ein Werk der Duftkünstlerin Claudia Vogel, dokumentiert mittels in Ether aufgelöster, ausgepresster Binden ein im Langzeitversuch entstandenes Duftselbstporträts, das das Selbst auf erschütternd wenig gelbliche, ölige Substanz reduziert.
Die in New York lebende Brasilianerin Valeska Soares kontrastiert in der "Fainting Couch" eine klinisch sterile, durchlöcherte Liege mit intensiv aus diesen Löchern dünstendem Duft von Stargazer-Lilien; das schafft Assoziationsbrücken zwischen Verführung und Vergiftung, verlinkt Glück und Vergänglichkeit. Schräg gegenüber hinterfragt der Kolumbianer Oswaldo Maciá mit einer stinkenden Knoblauchseife in einer kleinen asiatischen Kosmetikdose augenzwinkernd kulturelle Konventionen. Während "Smell you, smell me", eine Videoarbeit der in Athen geborenen Jenny Marketou, im Stil trashiger Talkshows anhand von zehn Einzelbeispielen das Einzigartige von Geruchserlebnissen herausarbeitet.
So mäandert die Ausstellung, deren Titel "Belle Haleine" (der schöne Atem) anspielt auf ein Readymade von Marcel Duchamp, das aus einem Parfumflakon von 1921 entstand, durch das Universum des Olfaktorischen ohne einer chronologischen Ordnung zu folgen oder den Anspruch auf eine kulturgeschichtlich umfassende Darstellung zu erheben. Zwar gibt’s einen Prolog, der den Wandel der Geruchsrezeption nachzeichnet – von den allegorischen, unmittelbaren Darstellungen im 17. Jahrhundert bis zu Arbeiten der 1920er Jahre von Man Ray oder Marcel Duchamp. Exponate aus dem Umkreis der Pop-Art und der Konzeptkunst, die mit Tabus spielen – Piero Manzonis Konservendose "Merda d’artitsa" von 1961 etwa, in der er vorgab 30 Gramm "Künstlerscheiße" eingedost zu haben, oder Dieter Roths "Poemetrie" von 1968, für die er bedruckte Plastikbeutel mit Vanillepudding und Urin befüllte – verströmen nicht nur den rebellischen Geist der 60er-Jahre, sie machen auch bewusst, dass schon ein Wissen um Materialien reicht, bestimmte Geruchsempfindungen zu evozieren.
Beeindruckend aber sind vor allem die großen Skulpturen und Installationen von Ernesto Neto oder Carsten Höller & François Roche. Netos mit Kurkuma, Ingwer und Pfeffer gefüllte Säcke, die der Brasilianer zur gigantischen Hängeskulptur "While nothing happens" komponiert und die wie Tentakeln einer Riesenqualle unter deren Schirm im Raum schweben, affizieren alle Sinne. Da entsteht der Eindruck, dass Kunst, die viele Sinne anspricht, mehr bietet. Eine Erfahrung, die die letzte Station des olfaktorischen Parcours bestätigt: Da schickt Cildo Meireles in der begehbaren Installation "Volátil" quasi ins Gas, genauer in eine mit Talkum ausgelegte, dunkle, u-förmige Holzkonstruktion mit brennender Kerze als Endpunkt, in die harmloses Markierungsgas strömt. Das stimuliert ambivalente Gefühle, weckt Assoziationsketten bis zum Holocaust, bricht solche negativen Konnotationen aber auch durch das angenehme Gefühl des Babypuders an den nackten Füßen. Das macht nicht zuletzt neugierig auf die nächste Folge dieser auf fünf Teile angelegten Serie, die 2016 dem Tastsinn gewidmet sein wird. Die Nase voll hat man von diesem Projekt nach dem Auftakt jedenfalls nicht.
– Bis 17. Mai, Di - So 11 – 18 Uhr, Museum Tinguely Basel, Paul Sacher Anlage; 14. Februar, 19.30 Uhr Film "Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders" und von 22 Uhr an Pheromonparty mit Djs von Michael Baas
Schon beim Betreten des Gebäudes ziehen Aromen in die Nase, die an orientalische Gewürzbasare erinnern. "Ein Ausstellungsexperiment" nennen Museumsdirektor Roland Wetzel und Kuratorin Annja Müller-Alsbach die Schau denn auch, ein Experiment, das anknüpft an die Öffnung des Kunstbegriffs seit den 60er Jahren, in der Linie Alltag thematisiert und das vor allem auf Basis neuerer Arbeiten der letzten 20 Jahre. In einigen Fällen sind die gar in separaten, eigens im Museum aufgestellten Boxen installiert – kleine Laboratorien zur Geruchsforschung, in denen das Museum sein Pfund, das von seinem Ahnherren Tinguely mitinitiierte Prinzip interaktiver, partizipativer Kunst gut ausspielen kann – nicht zuletzt im Duftkino zu dessen Film "Study for an End of the World No 2".
Die in Berlin lebende norwegische Künstlerin, Chemikerin und Geruchsforscherin Sissel Tolaas, die im Vorjahr für das Militärhistorische Museum Dresden den Geruch von Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs rekonstruierte, konfrontiert da in einem dieser "White Cubes" mit dem Angstschweiß von elf Männern und weckt damit Impulse zwischen Neugier und Davonlaufen. Die Installation "The Fear of Smell – the Smell of Fear" entstand im Auftrag der amerikanischen Denkfabrik MIT während der Präsidentschaft von Georg Bush junior als Reaktion auf die kollektive Paranoia nach den Terroranschlägen in New York 2001. Sie basiert auf einer Studie, die den Schweiß von 21 Phobikern erfasste, dessen Duftmoleküle analysierte, synthetisierte und aufwändig mikroinkapsulierte, so dass Wände damit präpariert werden können. Die unterschiedlich getönten Streifen materialisieren nun nicht nur Individuen allein im Geruch, in deren Erleben offenbart sich auch der gesellschaftliche Umgang der Betrachter mit diesen Gerüchen.
Überhaupt ist das Einfangen, Materialisieren und Festhalten des flüchtigen Phänomens Duft und daran anknüpfende Assoziationen ein roter Faden, der sich durchzieht: Da hat die Schweizerin Anna-Sabina Zürrer für die Arbeit "Wald" einen Kubikmeter Nadelwald destilliert und eine Essenz gewonnen, die aus Glasfläschchen mit Blick auf den Rhein und die Basler Stadtautobahn im Museum versprüht werden darf und ein Aroma zwischen Saunaaufguss und Waldspaziergang verströmt. Oder "Concrete 2,3 g", ein Werk der Duftkünstlerin Claudia Vogel, dokumentiert mittels in Ether aufgelöster, ausgepresster Binden ein im Langzeitversuch entstandenes Duftselbstporträts, das das Selbst auf erschütternd wenig gelbliche, ölige Substanz reduziert.
Die in New York lebende Brasilianerin Valeska Soares kontrastiert in der "Fainting Couch" eine klinisch sterile, durchlöcherte Liege mit intensiv aus diesen Löchern dünstendem Duft von Stargazer-Lilien; das schafft Assoziationsbrücken zwischen Verführung und Vergiftung, verlinkt Glück und Vergänglichkeit. Schräg gegenüber hinterfragt der Kolumbianer Oswaldo Maciá mit einer stinkenden Knoblauchseife in einer kleinen asiatischen Kosmetikdose augenzwinkernd kulturelle Konventionen. Während "Smell you, smell me", eine Videoarbeit der in Athen geborenen Jenny Marketou, im Stil trashiger Talkshows anhand von zehn Einzelbeispielen das Einzigartige von Geruchserlebnissen herausarbeitet.
Titel spielt auf ein Readymade von Marcel Duchamp an
So mäandert die Ausstellung, deren Titel "Belle Haleine" (der schöne Atem) anspielt auf ein Readymade von Marcel Duchamp, das aus einem Parfumflakon von 1921 entstand, durch das Universum des Olfaktorischen ohne einer chronologischen Ordnung zu folgen oder den Anspruch auf eine kulturgeschichtlich umfassende Darstellung zu erheben. Zwar gibt’s einen Prolog, der den Wandel der Geruchsrezeption nachzeichnet – von den allegorischen, unmittelbaren Darstellungen im 17. Jahrhundert bis zu Arbeiten der 1920er Jahre von Man Ray oder Marcel Duchamp. Exponate aus dem Umkreis der Pop-Art und der Konzeptkunst, die mit Tabus spielen – Piero Manzonis Konservendose "Merda d’artitsa" von 1961 etwa, in der er vorgab 30 Gramm "Künstlerscheiße" eingedost zu haben, oder Dieter Roths "Poemetrie" von 1968, für die er bedruckte Plastikbeutel mit Vanillepudding und Urin befüllte – verströmen nicht nur den rebellischen Geist der 60er-Jahre, sie machen auch bewusst, dass schon ein Wissen um Materialien reicht, bestimmte Geruchsempfindungen zu evozieren.
Beeindruckend aber sind vor allem die großen Skulpturen und Installationen von Ernesto Neto oder Carsten Höller & François Roche. Netos mit Kurkuma, Ingwer und Pfeffer gefüllte Säcke, die der Brasilianer zur gigantischen Hängeskulptur "While nothing happens" komponiert und die wie Tentakeln einer Riesenqualle unter deren Schirm im Raum schweben, affizieren alle Sinne. Da entsteht der Eindruck, dass Kunst, die viele Sinne anspricht, mehr bietet. Eine Erfahrung, die die letzte Station des olfaktorischen Parcours bestätigt: Da schickt Cildo Meireles in der begehbaren Installation "Volátil" quasi ins Gas, genauer in eine mit Talkum ausgelegte, dunkle, u-förmige Holzkonstruktion mit brennender Kerze als Endpunkt, in die harmloses Markierungsgas strömt. Das stimuliert ambivalente Gefühle, weckt Assoziationsketten bis zum Holocaust, bricht solche negativen Konnotationen aber auch durch das angenehme Gefühl des Babypuders an den nackten Füßen. Das macht nicht zuletzt neugierig auf die nächste Folge dieser auf fünf Teile angelegten Serie, die 2016 dem Tastsinn gewidmet sein wird. Die Nase voll hat man von diesem Projekt nach dem Auftakt jedenfalls nicht.
– Bis 17. Mai, Di - So 11 – 18 Uhr, Museum Tinguely Basel, Paul Sacher Anlage; 14. Februar, 19.30 Uhr Film "Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders" und von 22 Uhr an Pheromonparty mit Djs von Michael Baas
am
Do, 12. Februar 2015 um 07:36 Uhr