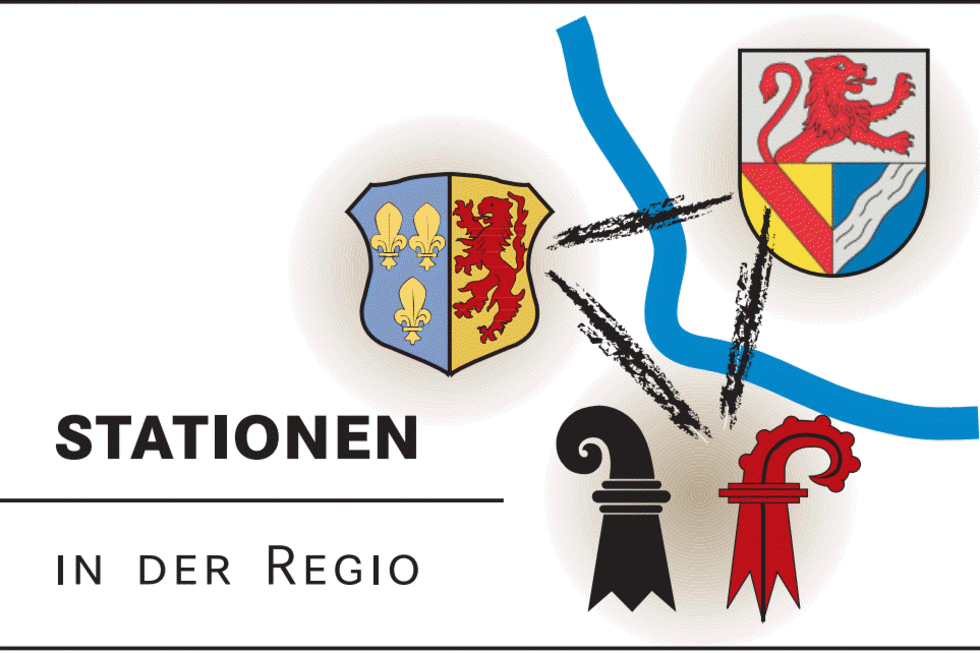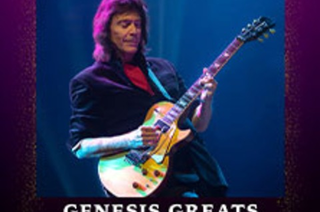Augst
Führung durch die Depots der Römerstadt Augusta Raurica
AUGST. Theater und Tempel, Forum und Römerhaus kennt jeder Besucher von Augusta Raurica. Einen Blick hinter die Kulissen der Römerstadt vor den Toren Basels ermöglicht eine Führung durch die Museumsdepots. Sandra Ammann erläutert, aus welch riesigem Fundus das Römermuseum in Augst (Kanton Baselland) schöpfen kann: Rund 1,7 Millionen Objekte umfasst die Sammlung.
Es geht rechts an der antiken Taberna vorbei, zur alten Scheune, in der sowohl das Büro für die Restaurierung sowie das Inventarbüro untergebracht sind. In den Regalen stapeln sich die mit Fundstücken vollgestopften Kisten. Auf einem Tisch in der Mitte des Raumes liegen zahlreiche Ton- und Glasscherben offen herum. Insgesamt vier Mitarbeiterinnen katalogisieren sämtliche. Bei insgesamt 1,7 Millionen Fundstücken in Augusta Raurica eine Herkulesaufgabe. Auf dem Gelände selbst wird heute allerdings nicht mehr viel gegraben, erzählt Ammann. Oftmals ließen sich über Luftaufnahmen Grundrisse erkennen, da das Gras auf den antiken Mauerresten nicht so gut wachse. So kenne man die Stadt auch, ohne alles ausgegraben zu haben.
Ansonsten kommen vor allem bei Bauarbeiten neue Funde zum Vorschein. Dann wird Schicht für Schicht alles abgetragen, katalogisiert und landet dann erst einmal in den Museumsdepots. Pro Jahr seien das zwischen 50 000 und 60 000 Fundstücke, erklärt Ammann. Besonders hilfreich bei der Datierung sind Münzen. Während auf den modernen Euro- und Schweizer Frankenmünzen das Jahr eingraviert ist, lassen sich römische Münzen durch den auf ihnen abgebildeten Kaiser zeitlich einordnen und somit auch der entsprechende Fund. Dabei kooperiert man auch mit Spezialisten und zieht beispielsweise Anthropologen zur Bestimmung menschlicher Überreste hinzu.
Durch eine kleine Tür, an der ein Indiana-Jones-Plakat hängt, geht es ins Inventarbüro. Dort stapeln sich ebenfalls die noch zu katalogisierenden Funde, untergebracht in einfachen Bananenkartons. Die Arbeit habe sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert, erklärt Sammlungsleiterin Ammann. Damals habe man noch viel mehr restauriert. Auch die Fragestellungen der Archäologen an die Fundstücke seien vom jeweiligen Zeitgeist geprägt.
Gegenüber der Scheune liegt der gut beheizte Waschraum. Ammann nimmt eine Tonscherbe in die Hand und zeigt sie herum. An dem Überrest eines Kochtopfs sind auch mehr als 2000 Jahre später noch immer verkohlte Breireste erkennbar. "Das Einordnen der Funde ist keine Hexerei", erklärt die Archäologin. Wie auch in der Biologie greife man auf das große Vorwissen früherer Generationen zurück. So ließen sich zum Beispiel bestimmte Keramikarten eindeutig einer bestimmten Epoche und Herkunft zuordnen. Bei antikem Glas seien zudem immer eingeschlossene Luftblasen zu finden. Doch auch wenn auf dem Gelände bislang 600 Gräber mit mehr als 100 000 Fundstücken entdeckt wurden, fehlen noch immer tausende Gräber. Immerhin lebten in der Antike bis zu 20 000 Einwohner in Augusta Raurica.
Zum Schluss führt Ammann noch in den Keller des Museums. Dort ist das Kleinfunddepot untergebracht, dessen Räume passend zu den Funden ebenfalls winzig sind. Geordnet nach Material stapeln sich die Plastikkisten mit Ton, Glas und Steinen. Dabei wird auf eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit geachtet, um die Stücke möglichst gut zu erhalten.
Ansonsten kommen vor allem bei Bauarbeiten neue Funde zum Vorschein. Dann wird Schicht für Schicht alles abgetragen, katalogisiert und landet dann erst einmal in den Museumsdepots. Pro Jahr seien das zwischen 50 000 und 60 000 Fundstücke, erklärt Ammann. Besonders hilfreich bei der Datierung sind Münzen. Während auf den modernen Euro- und Schweizer Frankenmünzen das Jahr eingraviert ist, lassen sich römische Münzen durch den auf ihnen abgebildeten Kaiser zeitlich einordnen und somit auch der entsprechende Fund. Dabei kooperiert man auch mit Spezialisten und zieht beispielsweise Anthropologen zur Bestimmung menschlicher Überreste hinzu.
Durch eine kleine Tür, an der ein Indiana-Jones-Plakat hängt, geht es ins Inventarbüro. Dort stapeln sich ebenfalls die noch zu katalogisierenden Funde, untergebracht in einfachen Bananenkartons. Die Arbeit habe sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert, erklärt Sammlungsleiterin Ammann. Damals habe man noch viel mehr restauriert. Auch die Fragestellungen der Archäologen an die Fundstücke seien vom jeweiligen Zeitgeist geprägt.
Gegenüber der Scheune liegt der gut beheizte Waschraum. Ammann nimmt eine Tonscherbe in die Hand und zeigt sie herum. An dem Überrest eines Kochtopfs sind auch mehr als 2000 Jahre später noch immer verkohlte Breireste erkennbar. "Das Einordnen der Funde ist keine Hexerei", erklärt die Archäologin. Wie auch in der Biologie greife man auf das große Vorwissen früherer Generationen zurück. So ließen sich zum Beispiel bestimmte Keramikarten eindeutig einer bestimmten Epoche und Herkunft zuordnen. Bei antikem Glas seien zudem immer eingeschlossene Luftblasen zu finden. Doch auch wenn auf dem Gelände bislang 600 Gräber mit mehr als 100 000 Fundstücken entdeckt wurden, fehlen noch immer tausende Gräber. Immerhin lebten in der Antike bis zu 20 000 Einwohner in Augusta Raurica.
Zum Schluss führt Ammann noch in den Keller des Museums. Dort ist das Kleinfunddepot untergebracht, dessen Räume passend zu den Funden ebenfalls winzig sind. Geordnet nach Material stapeln sich die Plastikkisten mit Ton, Glas und Steinen. Dabei wird auf eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit geachtet, um die Stücke möglichst gut zu erhalten.
Die nächsten Führungen finden am 31. Januar, 28. Februar und 27. März 2016 statt. Der Eintritt beträgt zehn Franken, ermäßigt fünf Franken. Anmeldung und Vorverkauf unter Tel. 004161/5522222.
von Ansgar Taschinski
am
Mo, 14. Dezember 2015