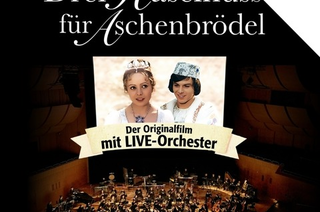Kunst
"Göttlicher Herrscher am Nil": Ramses II. im Karlsruher Badischen Landesmuseum
Die Bibel nennt ihn. In den Büchern Mose kommt sein Name mehrfach vor. Aber hat der Pharao Ramses II. historisch wirklich mit dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten zu tun? Gewiss ist nur, dass dieser Ramses in der langen Reihe der Herrscher am Nil eine besondere Stellung einnimmt. Sein Ansehen zu Lebzeiten stellt sich in unzähligen Standbildern dar, und der Basler Ägyptologe Erik Hornung nennt ihn schlicht einen "Pharao der Rekorde". Eine ganze Reihe designierter Thronfolger hat er überlebt. Als er im Jahr 1213 v. Chr. starb, war er im 67. Amtsjahr. Er war der große Bauherr des Alten Ägypten, ein Gründer und Vollender vieler Tempel, von denen die beiden Felsentempel in Abu Simbel vielleicht die berühmtesten sind.
"Es ist schön, Denkmal auf Denkmal zu errichten", sagt eine Inschrift in Abydos. Die Ausstellung im Badischen Landesmuseum über den "Göttlichen Herrscher am Nil" lässt die neuesten Forschungsergebnisse auf dem Feld der von Ramses im Nildelta erbauten Hauptstadt Pi-Ramesse anschaulich werden. Pi-Ramesse heißt nichts anderes als "Haus des Ramses", ihr Beiname war "Groß an Siegen".
Erzählt wird in Karlsruhe die Geschichte des ehrgeizigen Feldherrn Ramses. Doch vor allem auch die des Friedensarchitekten. Die Schlacht gegen die Hethiter vor der vorderasiatischen Stadt Kadesch war nicht die glorreiche Heldentat, zu der der König sie propagandistisch geschickt stilisierte, eher eine knapp abgewendete Niederlage. Von weitreichender Folge war dagegen die Entscheidung, die Konflikte mit dem mächtigen Nachbarn diplomatisch zu lösen. Es ist dies der weltweit erste dokumentierte Friedensvertrag. Der ägyptische Sonnengott und der hethitische Wettergott sollten fortan kooperieren, die beiden Landesherrn korrespondierten lebhaft und tauschten Geschenke. Ramses und Hattusilis nannten sich "Bruder" und besiegelten den Pakt durch einen Ehebund. Der Ägypter wurde der Schwiegersohn des Hethiters.
Doch eingehend gewürdigt findet sich in der Schau nun auch die Frau, die Ramses II. unter allen "großen königlichen Gemahlinnen" die liebste war: Nefertari. Und porträtiert mit Funden aus dessen Grab der Sohn Chaemwese, ein Gelehrter und Hoher Priester. Im 52. Regierungsjahr seines Vaters wurde er Kronprinz, im 55. starb er. Der "große Gott" regierte noch immer weiter. Unsterblich war er nicht, wohl aber sein Nachruhm, wie man sieht.
Termine: Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, Schlossbezirk 10. 17. Dez. bis 18. Juni 2017, Di bis Do 10–17, Fr bis So 10–18 Uhr von Volker Bauermeister
"Es ist schön, Denkmal auf Denkmal zu errichten", sagt eine Inschrift in Abydos. Die Ausstellung im Badischen Landesmuseum über den "Göttlichen Herrscher am Nil" lässt die neuesten Forschungsergebnisse auf dem Feld der von Ramses im Nildelta erbauten Hauptstadt Pi-Ramesse anschaulich werden. Pi-Ramesse heißt nichts anderes als "Haus des Ramses", ihr Beiname war "Groß an Siegen".
Erzählt wird in Karlsruhe die Geschichte des ehrgeizigen Feldherrn Ramses. Doch vor allem auch die des Friedensarchitekten. Die Schlacht gegen die Hethiter vor der vorderasiatischen Stadt Kadesch war nicht die glorreiche Heldentat, zu der der König sie propagandistisch geschickt stilisierte, eher eine knapp abgewendete Niederlage. Von weitreichender Folge war dagegen die Entscheidung, die Konflikte mit dem mächtigen Nachbarn diplomatisch zu lösen. Es ist dies der weltweit erste dokumentierte Friedensvertrag. Der ägyptische Sonnengott und der hethitische Wettergott sollten fortan kooperieren, die beiden Landesherrn korrespondierten lebhaft und tauschten Geschenke. Ramses und Hattusilis nannten sich "Bruder" und besiegelten den Pakt durch einen Ehebund. Der Ägypter wurde der Schwiegersohn des Hethiters.
Doch eingehend gewürdigt findet sich in der Schau nun auch die Frau, die Ramses II. unter allen "großen königlichen Gemahlinnen" die liebste war: Nefertari. Und porträtiert mit Funden aus dessen Grab der Sohn Chaemwese, ein Gelehrter und Hoher Priester. Im 52. Regierungsjahr seines Vaters wurde er Kronprinz, im 55. starb er. Der "große Gott" regierte noch immer weiter. Unsterblich war er nicht, wohl aber sein Nachruhm, wie man sieht.
Termine: Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, Schlossbezirk 10. 17. Dez. bis 18. Juni 2017, Di bis Do 10–17, Fr bis So 10–18 Uhr von Volker Bauermeister
am
Fr, 16. Dezember 2016