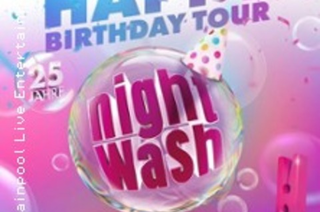Werkschau
Große Georg-Scholz-Ausstellung in Waldkirch
Nur 55 Jahre alt ist Georg Scholz geworden und doch hat er der Nachwelt zahlreiche Gemälde, Lithographien und Zeichnungen hinterlassen: ein Werk, das die wirren Zeitläufe, die sein Leben prägten, mit all seinen aufstrebenden Phasen und mit all seinen Brüchen widerspiegelt. Jetzt wird sein Werk im Elztalmuseum gezeigt.
Kuratorin Evelyn Flögel ist stolz, dass durch das emsige Wirken des Museumsteams eine so umfassende Ausstellung präsentiert werden kann. Die Basis dafür bildet die eigene städtische Sammlung, die nicht zuletzt durch Alt-OB Richard Leibinger über 30 Jahre hinweg zusammengetragen wurde. Dazu kommt der Nachlass des Malers aus dessen Familie – vieles davon war noch nie öffentlich ausgestellt. Ergänzt wird dies durch wichtige Werke aus den 1920er Jahren als Leihgaben aus Berlin, Mannheim, Kaiserslautern und Karlsruhe. Diese nach Waldkirch zu bekommen, war nicht einfach: "Georg Scholz ist international unterwegs", erläutert Evelyn Flögel. In New York und Los Angeles werden gerade Werke der Neuen Sachlichkeit in Deutschland präsentiert – da darf Georg Scholz als einer der wichtigsten Protagonisten dieser Kunstrichtung nicht fehlen. Auch Venedig rangelte um Leihgaben. Umso glücklicher ist man im Elztalmuseum, ab kommendem Sonntag eine komplette Etage Scholz in all seiner Vielfalt zeigen zu können.
Die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut und zeigt daher anschaulich, welche Entwicklung der Künstler genommen hat. Aus dem Frühwerk zu sehen sind beispielsweise ein Selbstporträt von 1908 sowie die Lithographien "Tod und Amor" und "Hüte dich, schön’s Blümelein" (nach Clemens Brentano: "Es ist ein Schnitter, der heißt Tod"), beide von 1909, als Georg Scholz gerade 19 Jahre alt war. Der Erste Weltkrieg führt zum ersten starken Bruch in seinem Leben: Er selbst muss ins Feld und erlebt das Grauen dieses Krieges. In den Kampfpausen zeichnet er mit Blei- und Buntstiften auf Postkarten und Papier, das sich sonst noch findet, Soldaten, Schlachtfelder, Lazarett und Gräber – und verändert schließlich seinen Stil. Seine "Wolhynische Landschaft", eine nach seiner Rückkehr 1919 entstandene Lithographie, fällt in seine beginnende expressionistische Phase, die von einer futuristischen abgelöst wird: Ein Kriegsversehrter auf Krücken läuft einen Weg entlang, Grabkreuze bedecken einen Hügel. Die Landschaft scheint nach dem Krieg verbogen zu sein, eben nicht mehr die selbe wie vorher.
Die Zwanziger Jahre eröffnen der Gesellschaft offene Räume, die auch Künstlern ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Scholz schärft seine Darstellungen über die Gesellschaft, entlarvt sie bitter-böse: Die "Wucherbauerfamilie" (1920) ist so ein Beispiel – Scholz, so berichtet Evelyn Flögel, soll zuvor bei den Bauern um Essen gebeten haben: Sie schickten ihn zum Misthaufen. Scholz’ Lithographie ist seine Art der Rache.
Geradezu als unheimlich scharfsichtig erweist er sich mit der "Apotheose des Kriegervereins" (1921): Drei deutsch-nationale Vertreter des Kriegervereins mit Hakenkreuz am Revers stehen vor dem Wirtshaus "Zum eisernen Hindenburg"; am Himmel lümmeln Kaiser Wilhelm und Bismarck auf einem Wölkchen wie dazumal Raffaels Engel. Ebenfalls nur auf den ersten Blick idyllisch ist die "Deutsche Kleinstadt bei Tage" (1923, sonst in Berlin zu sehen). Zum Broterwerb zeichnet Scholz Buchillustrationen, unter anderem für "Don Quijote", von denen einige in der Ausstellung zu sehen sind.
Ab Mitte der 1920er Jahre wendet sich Georg Scholz der neuen Sachlichkeit zu – und ist zeitgleich Professor an der Badischen Landeskunstschule in Karlsruhe. Jetzt entstehen schöne Ölgemälde – für die nun auch Geld da ist: ein "Sitzender weiblicher Akt mit antiker Büste" entsteht (sonst in der Kunsthalle Karlsruhe zu sehen), das Kakteen-Stilleben (Pfalzgalerie Kaiserslautern) und das Bahnwärterhaus (Kunstpalast Düsseldorf). Bei den "Schwestern" und "Elisabeth am Fenster" ist jedes Detail fein ausgearbeitet, sogar die glänzenden Seidenstrümpfe. Immer wieder steht Elisabeth Scholz, Georg Scholz’ Ehefrau, Modell. Viele dieser Bilder befinden sich in Privatbesitz, aber dürfen nun hier erstmals im Elztalmuseum einem breiten Publikum gezeigt werden.
Die Nazis verurteilen Scholz’ Bilder als "entartet" und werfen ihn aus dem Lehramt. Durch Vermittlung eines Freundes ergibt sich für ihn die Möglichkeit, sich nach Waldkirch zurückzuziehen, "um vergessen zu werden", wie Evelyn Flögel markant beschreibt. Alles andere wäre lebensgefährlich. Scholz malt weiter, aber er ist ein anderer geworden. Der früher scharfe Linolschnitt weicht verwaschenen Aquarellen, lebensleer und trübsinnig ist seine "Obstplantage im Winter II" (1936). Statt Details aus nächster Nähe zu zeichnen, begibt er sich an weit entfernte Standorte oder überstreicht quasi sämtliche Einzelheiten. "Scholz ist ein Beispiel dafür, was diese unsägliche Zeit mit Menschen gemacht hat", unterstreicht Flögel.
Am 15. Oktober 1945 ernennen ihn die französischen Besatzer zum ersten Nachkriegs-Bürgermeister von Waldkirch. Gerade mal vier Wochen ist er im Amt, ehe er stirbt.
Städtische Sammlung und Leihgaben
Kuratorin Evelyn Flögel ist stolz, dass durch das emsige Wirken des Museumsteams eine so umfassende Ausstellung präsentiert werden kann. Die Basis dafür bildet die eigene städtische Sammlung, die nicht zuletzt durch Alt-OB Richard Leibinger über 30 Jahre hinweg zusammengetragen wurde. Dazu kommt der Nachlass des Malers aus dessen Familie – vieles davon war noch nie öffentlich ausgestellt. Ergänzt wird dies durch wichtige Werke aus den 1920er Jahren als Leihgaben aus Berlin, Mannheim, Kaiserslautern und Karlsruhe. Diese nach Waldkirch zu bekommen, war nicht einfach: "Georg Scholz ist international unterwegs", erläutert Evelyn Flögel. In New York und Los Angeles werden gerade Werke der Neuen Sachlichkeit in Deutschland präsentiert – da darf Georg Scholz als einer der wichtigsten Protagonisten dieser Kunstrichtung nicht fehlen. Auch Venedig rangelte um Leihgaben. Umso glücklicher ist man im Elztalmuseum, ab kommendem Sonntag eine komplette Etage Scholz in all seiner Vielfalt zeigen zu können.
Der erste Einschnitt: der Erste Weltkrieg
Die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut und zeigt daher anschaulich, welche Entwicklung der Künstler genommen hat. Aus dem Frühwerk zu sehen sind beispielsweise ein Selbstporträt von 1908 sowie die Lithographien "Tod und Amor" und "Hüte dich, schön’s Blümelein" (nach Clemens Brentano: "Es ist ein Schnitter, der heißt Tod"), beide von 1909, als Georg Scholz gerade 19 Jahre alt war. Der Erste Weltkrieg führt zum ersten starken Bruch in seinem Leben: Er selbst muss ins Feld und erlebt das Grauen dieses Krieges. In den Kampfpausen zeichnet er mit Blei- und Buntstiften auf Postkarten und Papier, das sich sonst noch findet, Soldaten, Schlachtfelder, Lazarett und Gräber – und verändert schließlich seinen Stil. Seine "Wolhynische Landschaft", eine nach seiner Rückkehr 1919 entstandene Lithographie, fällt in seine beginnende expressionistische Phase, die von einer futuristischen abgelöst wird: Ein Kriegsversehrter auf Krücken läuft einen Weg entlang, Grabkreuze bedecken einen Hügel. Die Landschaft scheint nach dem Krieg verbogen zu sein, eben nicht mehr die selbe wie vorher.
Entwicklungsmöglichkeiten in den goldenen Zwanzigern
Die Zwanziger Jahre eröffnen der Gesellschaft offene Räume, die auch Künstlern ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Scholz schärft seine Darstellungen über die Gesellschaft, entlarvt sie bitter-böse: Die "Wucherbauerfamilie" (1920) ist so ein Beispiel – Scholz, so berichtet Evelyn Flögel, soll zuvor bei den Bauern um Essen gebeten haben: Sie schickten ihn zum Misthaufen. Scholz’ Lithographie ist seine Art der Rache.
Geradezu als unheimlich scharfsichtig erweist er sich mit der "Apotheose des Kriegervereins" (1921): Drei deutsch-nationale Vertreter des Kriegervereins mit Hakenkreuz am Revers stehen vor dem Wirtshaus "Zum eisernen Hindenburg"; am Himmel lümmeln Kaiser Wilhelm und Bismarck auf einem Wölkchen wie dazumal Raffaels Engel. Ebenfalls nur auf den ersten Blick idyllisch ist die "Deutsche Kleinstadt bei Tage" (1923, sonst in Berlin zu sehen). Zum Broterwerb zeichnet Scholz Buchillustrationen, unter anderem für "Don Quijote", von denen einige in der Ausstellung zu sehen sind.
Ab Mitte der 1920er Jahre wendet sich Georg Scholz der neuen Sachlichkeit zu – und ist zeitgleich Professor an der Badischen Landeskunstschule in Karlsruhe. Jetzt entstehen schöne Ölgemälde – für die nun auch Geld da ist: ein "Sitzender weiblicher Akt mit antiker Büste" entsteht (sonst in der Kunsthalle Karlsruhe zu sehen), das Kakteen-Stilleben (Pfalzgalerie Kaiserslautern) und das Bahnwärterhaus (Kunstpalast Düsseldorf). Bei den "Schwestern" und "Elisabeth am Fenster" ist jedes Detail fein ausgearbeitet, sogar die glänzenden Seidenstrümpfe. Immer wieder steht Elisabeth Scholz, Georg Scholz’ Ehefrau, Modell. Viele dieser Bilder befinden sich in Privatbesitz, aber dürfen nun hier erstmals im Elztalmuseum einem breiten Publikum gezeigt werden.
Rückzug nach Waldkirch
Die Nazis verurteilen Scholz’ Bilder als "entartet" und werfen ihn aus dem Lehramt. Durch Vermittlung eines Freundes ergibt sich für ihn die Möglichkeit, sich nach Waldkirch zurückzuziehen, "um vergessen zu werden", wie Evelyn Flögel markant beschreibt. Alles andere wäre lebensgefährlich. Scholz malt weiter, aber er ist ein anderer geworden. Der früher scharfe Linolschnitt weicht verwaschenen Aquarellen, lebensleer und trübsinnig ist seine "Obstplantage im Winter II" (1936). Statt Details aus nächster Nähe zu zeichnen, begibt er sich an weit entfernte Standorte oder überstreicht quasi sämtliche Einzelheiten. "Scholz ist ein Beispiel dafür, was diese unsägliche Zeit mit Menschen gemacht hat", unterstreicht Flögel.
Am 15. Oktober 1945 ernennen ihn die französischen Besatzer zum ersten Nachkriegs-Bürgermeister von Waldkirch. Gerade mal vier Wochen ist er im Amt, ehe er stirbt.
Info: Zu sehen sind die Werke von Georg Scholz bis zum 29. November im Elztalmuseum Waldkirch (Kirchplatz 14). Außerdem wurde ein neuer Katalog gedruckt, der sowohl die gezeigten Werke als auch weitere von Georg Scholz beinhaltet (erhältlich im Museum für 19 Euro).
von Sylvia Timm
am
Di, 22. September 2015 um 15:39 Uhr