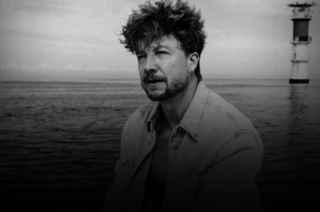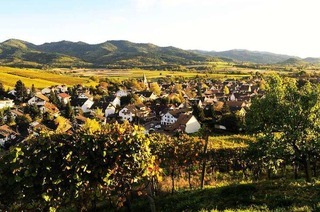Wo es wackelt, rüttelt, hopst
Tinguely-Museum in Basel
Vor der Scheibe: das Kind, zwergenklein im Vergleich. Stutzt, bleibt stehen, guckt wie gebannt. "Booaahh!" Dahinter: ein wahres Monstrum. Es bewegt sich wild und kommt doch nicht vom Fleck. Stattdessen kommt Bewegung ins Kind: "Alter, ich dachte, das wird heute ein langweiliger Tag, aber das sieht ja richtig cool aus, kommt, schnell rein", ruft’s, zieht seine Freunde Richtung Eingang – so begeistert sind die Kinder noch nie in ein Museum gerannt. Aber es ist auch nicht irgendeins, gewidmet ist es Jean Tinguely, dem Schweizer Künstler. Dem Meister der Maschinen, die er aus Schrott gebaut hat.
Und so außergewöhnlich wie der Künstler war, sind auch die Dinge, die es zu entdecken gibt: Kann man den Zufall zeichnen? Wie das geht, will uns Beat Klein zeigen, der im Museum Angebote für Kinder, aber auch Erwachsene ausrichtet – denn Tinguelys Kunst ist so spielerisch und kreativ, dass selbst Methusalem das Kind in sich entdecken würde.
Ein Stift flitzt übers Papier, gehalten von einer Tinguely-Maschine. Die klopft, scheppert und rattert wie eine heiß gelaufene Nähmaschine, angetrieben von einem Motor, der erst ein Rad, dann noch eins und das wiederum das nächste antreibt – bis hin zu eben diesem Stift, der hüpft, tupft und zappelt, je nachdem, wie der Kinderfuß den großen, roten Fußschalter drückt: Fertig ist das Kritzelkratzel. Kunst muss nicht gefallen, aber kann – und Spaß machen sowieso.
Viel Spaß macht auf jeden Fall die "Grosse Méta-Maxi-Utopia" von 1987, die aussieht wie eine Mischung aus Lokomotive, Fracht- und Raumschiff auf der Reise in ein Fantasieland. Drei Kinder stehen davor, staunen sprachlos. Mannmannmann – ist das groß. Ein Riesenteil, mit einem Räderwerk aus zusammengeschweißtem Schrott wie bei Charlie Chaplins Modern Times. Miteingebaut sind Rennwagenräder, sie verraten Tinguelys große Faszination für den Motorsport. Flohmarktgefühl kommt auf. Montiert hat Tinguely auch Jahrmarkt- und Theaterutensilien wie ein großes Karussellpferd oder einen schweren roten Vorhang.
Die Kinder und wir Erwachsenen erlaufen uns ein übergroßes, begehbares Wimmelbuch in 3D, gehen über Treppen und Galerien, werden damit selbst Teil der Kunst. Wir entdecken im Technikmischmasch hübsch aufgereihte Plastikblumen, eine Abwaschanlagenbürste oder einen riesigen Gartenzwerg, der mit seiner Mütze kopfüber in der Regentonne hängt. Und dazwischen jede Menge große und kleine Räder sowie 29 Motoren.
Auf Fußknopfdruck geht das Pfeifen, Quietschen, Scheppern und Rotieren los. Der Vorhang geht auf und zu, das Pferd schaukelt, die Räder drehen sich und die Zwergenmütze rührt das Wasser in der Regentonne wie Kuchenteig: Fertig machen und abheben zur Reise nach Utopia. Ein paar Minuten klappert die Maschine, dann macht sie wieder Pause, scheint auszuruhen und ignoriert jeden weiteren Fußknopfdruck. Erst Minuten später läuft sie wieder an. Nochmal und nochmal und wieder stopp.
Nächste Station: der "Mengele-Totentanz". Ein Raum mit Skulpturen aus verbogenem Eisen, ein wahres Gruselkabinett, das erst still steht, um dann auf Knopfdruck zu tanzen. Schatten huschen über die Wand, tanzen nach dem Takt der scheppernden Motoren – ein Zombi-Ballett könnte kaum grusliger sein. Das Material im Raum, erzählt Klein, stammt aus einem alten Bauernhof, der abgebrannt ist. Tinguely war vor Ort, trug Gegenstände aus dem niedergebrannten Haus. So wurde aus verbranntem Holz und verbogenen Metallteilen eine ganze Eisenfigurensammlung. Da eine der Maschinen das Fabrikat "Mengele" trug, war der Namen des morbiden Tanzensembles gefunden. "Ganz schön unheimlich, oder?", fragt Klein. Nönö, überhaupt gar nicht. Schnell rennen die Kinder raus.
Raum um Raum und Halle um Halle drücken sich die Kinderfüße durch die Ausstellung, bringen Musikmaschinen zum Klingen und Hexen, Hunde, Clowns zum Tanzen. Viel hat Tinguely geschaffen, langweilig wird’s nie. Selbst bei Gemälden sorgte der Künstler des Nouveau Réalisme für Abwechslung mit Reliefs, die sich veränderten, schaffte so bewegte Bilder für die Wohnzimmerwand.
Wir kommen mit unserem Rundgang zum Ende, gehen vorbei an Zeichenmaschinen und der Lebensgeschichte Tinguelys. Was, schon vorbei? Enttäuschte Gesichter. Gut, dass es im selben Haus eine Sonderausstellung gibt. Noch bis 17. Mai ist "Belle Haleine – Der Duft der Kunst" zu sehen – und zu riechen.
Denn wie riecht Kunst? Kann man Geruch sichtbar machen? Das versuchen Künstler mit Rauminstallationen, Plastiken und Objekten. Zwar sind nicht alle Werke für Kinder unter 16 Jahren geeignet. Wie die "Smoking Machine", die ohne fremde Hilfe alle Etappen des Rauchens vollführt, vom Anzünden übers Paffen bis zur Entsorgung – dementsprechend riecht’s auch nicht kindgerecht. Doch andere Räume sind dufte und machen auch Kindern Spaß, wie der des brasilianischen Künstlers Ernesto Neto. Dort hängen Duftsäckchen unter einem Baldachin, stehen welche wie Vasen auf dem Boden. Drinnen sind exotische Gewürze, die die Kinder krabbelnd auf allen vieren zu erschnuppern versuchen.
Tschüss, Himmelsmonsterrädermaschine, winken die Kinder wieder von außen, vor der Scheibe, dem Ding dahinter zu – nach einem duften Tag. von Anita Fertl
Und so außergewöhnlich wie der Künstler war, sind auch die Dinge, die es zu entdecken gibt: Kann man den Zufall zeichnen? Wie das geht, will uns Beat Klein zeigen, der im Museum Angebote für Kinder, aber auch Erwachsene ausrichtet – denn Tinguelys Kunst ist so spielerisch und kreativ, dass selbst Methusalem das Kind in sich entdecken würde.
Ein Stift flitzt übers Papier, gehalten von einer Tinguely-Maschine. Die klopft, scheppert und rattert wie eine heiß gelaufene Nähmaschine, angetrieben von einem Motor, der erst ein Rad, dann noch eins und das wiederum das nächste antreibt – bis hin zu eben diesem Stift, der hüpft, tupft und zappelt, je nachdem, wie der Kinderfuß den großen, roten Fußschalter drückt: Fertig ist das Kritzelkratzel. Kunst muss nicht gefallen, aber kann – und Spaß machen sowieso.
Viel Spaß macht auf jeden Fall die "Grosse Méta-Maxi-Utopia" von 1987, die aussieht wie eine Mischung aus Lokomotive, Fracht- und Raumschiff auf der Reise in ein Fantasieland. Drei Kinder stehen davor, staunen sprachlos. Mannmannmann – ist das groß. Ein Riesenteil, mit einem Räderwerk aus zusammengeschweißtem Schrott wie bei Charlie Chaplins Modern Times. Miteingebaut sind Rennwagenräder, sie verraten Tinguelys große Faszination für den Motorsport. Flohmarktgefühl kommt auf. Montiert hat Tinguely auch Jahrmarkt- und Theaterutensilien wie ein großes Karussellpferd oder einen schweren roten Vorhang.
Die Kinder und wir Erwachsenen erlaufen uns ein übergroßes, begehbares Wimmelbuch in 3D, gehen über Treppen und Galerien, werden damit selbst Teil der Kunst. Wir entdecken im Technikmischmasch hübsch aufgereihte Plastikblumen, eine Abwaschanlagenbürste oder einen riesigen Gartenzwerg, der mit seiner Mütze kopfüber in der Regentonne hängt. Und dazwischen jede Menge große und kleine Räder sowie 29 Motoren.
Auf Fußknopfdruck geht das Pfeifen, Quietschen, Scheppern und Rotieren los. Der Vorhang geht auf und zu, das Pferd schaukelt, die Räder drehen sich und die Zwergenmütze rührt das Wasser in der Regentonne wie Kuchenteig: Fertig machen und abheben zur Reise nach Utopia. Ein paar Minuten klappert die Maschine, dann macht sie wieder Pause, scheint auszuruhen und ignoriert jeden weiteren Fußknopfdruck. Erst Minuten später läuft sie wieder an. Nochmal und nochmal und wieder stopp.
Nächste Station: der "Mengele-Totentanz". Ein Raum mit Skulpturen aus verbogenem Eisen, ein wahres Gruselkabinett, das erst still steht, um dann auf Knopfdruck zu tanzen. Schatten huschen über die Wand, tanzen nach dem Takt der scheppernden Motoren – ein Zombi-Ballett könnte kaum grusliger sein. Das Material im Raum, erzählt Klein, stammt aus einem alten Bauernhof, der abgebrannt ist. Tinguely war vor Ort, trug Gegenstände aus dem niedergebrannten Haus. So wurde aus verbranntem Holz und verbogenen Metallteilen eine ganze Eisenfigurensammlung. Da eine der Maschinen das Fabrikat "Mengele" trug, war der Namen des morbiden Tanzensembles gefunden. "Ganz schön unheimlich, oder?", fragt Klein. Nönö, überhaupt gar nicht. Schnell rennen die Kinder raus.
Raum um Raum und Halle um Halle drücken sich die Kinderfüße durch die Ausstellung, bringen Musikmaschinen zum Klingen und Hexen, Hunde, Clowns zum Tanzen. Viel hat Tinguely geschaffen, langweilig wird’s nie. Selbst bei Gemälden sorgte der Künstler des Nouveau Réalisme für Abwechslung mit Reliefs, die sich veränderten, schaffte so bewegte Bilder für die Wohnzimmerwand.
Wir kommen mit unserem Rundgang zum Ende, gehen vorbei an Zeichenmaschinen und der Lebensgeschichte Tinguelys. Was, schon vorbei? Enttäuschte Gesichter. Gut, dass es im selben Haus eine Sonderausstellung gibt. Noch bis 17. Mai ist "Belle Haleine – Der Duft der Kunst" zu sehen – und zu riechen.
Denn wie riecht Kunst? Kann man Geruch sichtbar machen? Das versuchen Künstler mit Rauminstallationen, Plastiken und Objekten. Zwar sind nicht alle Werke für Kinder unter 16 Jahren geeignet. Wie die "Smoking Machine", die ohne fremde Hilfe alle Etappen des Rauchens vollführt, vom Anzünden übers Paffen bis zur Entsorgung – dementsprechend riecht’s auch nicht kindgerecht. Doch andere Räume sind dufte und machen auch Kindern Spaß, wie der des brasilianischen Künstlers Ernesto Neto. Dort hängen Duftsäckchen unter einem Baldachin, stehen welche wie Vasen auf dem Boden. Drinnen sind exotische Gewürze, die die Kinder krabbelnd auf allen vieren zu erschnuppern versuchen.
Tschüss, Himmelsmonsterrädermaschine, winken die Kinder wieder von außen, vor der Scheibe, dem Ding dahinter zu – nach einem duften Tag. von Anita Fertl
am
Fr, 17. April 2015