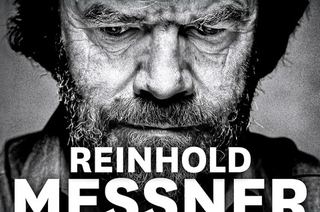Herzschlag der Liebe
Ein Paar im Restaurant, sie haben kein Geld dabei und machen sich aus dem Staub, jagen durch New York, liegen keuchend im Park, Küsse, Komplizenschaft, Glück des Verbotenen, Herzschlag der Liebe. Und während man noch überlegt, ob das jetzt das Vorspiel einer romantischen Komödie war, kommt diese zweite Szene, in der die Frau ihr Fahrrad auf einer Brücke abstellt und ins Wasser springt. Nein, "Das Verschwinden der Eleanor Rigby" von Ned Benson ist keine Romanze. Ein Liebesdrama aber durchaus, intensiv und berührend, wunderbar gespielt – und eines der erstaunlichsten Regiedebüts des vergangenen Jahres.
Vor allem das ursprüngliche Projekt: Benson, aufgewachsen in New York und Absolvent der Columbia University, hat seinen ersten Langfilm in zwei Varianten gedreht. "The Disappearence of Eleanor Rigby: Her" und "The Disappearence of Eleanor Rigby: Him" erzählen die gleiche Geschichte einmal aus der Perspektive der Frau, einmal aus der ihres Mannes, und die Kinogänger in Amerika konnten sich aussuchen, welche sie zuerst sehen wollten. Die gleiche Geschichte? Nicht ganz. Die beiden erleben identische Situationen sehr unterschiedlich, bis hinein in die Wahrnehmung von Kleiderfarben oder Wetter, eine Binsenweisheit in jeder Zweierbeziehung, gerade in Krisen und Konflikten. Aber wann hat das je ein Regisseur so radikal inszeniert?
Das Trauma, das das Glück dieses Paares gesprengt hat und beide an verschiedenen Ufern stranden ließ, ist der Tod ihres kleinen Sohnes. Der Film deutet ihn mehrfach an, aber auserzählt wird er nicht – wann und wie der Junge gestorben ist oder gar, ob einer der beiden Schuld daran trüge, ist unwichtig, es geht darum, wie die Trauer ein Liebespaar voneinander entfremdet. In den deutschen Kinos laufen – leider – nicht "Her" und "Him", sondern ein dritter Film: "Them", so der Untertitel, zeigt beider Sicht aufs Leben nach dem Verlust. Ein vergleichsweise konventionelles Drama, sicher, aber eines, das auf so schmerzliche wie tröstliche Weise unter die Haut geht.
Nicht zuletzt dank brillanter Schauspielerleistungen. Fangen wir mit den Nebenrollen an: Isabelle Huppert und William Hurt als die Eltern Rigby, die sich bei einem Beatles-Konzert in Paris kennengelernt haben und die Tochter deshalb Eleanor nannten. Vielleicht ist die Mutter, Französin, ein wenig zu klischeehaft ans Weinglas geklammert, und der Psychologenvater zu professionell in seinem Verständnis, aber beide sind herzzerreißend im Bemühen, der Tochter wieder hineinzuhelfen ins Leben. Das gelingt am ehesten der Universitätsdozentin, die Viola Davis als herrlich erdige, ironische und dabei hochsensible Gefährtin gibt.
Auch Eleanors Mann Conor ist nicht ohne Beistand. Aber der Vater (Ciarán Hinds) weiß nicht, ob und wie er ihm seine Liebe zeigen darf, und auch der beste Freund Stuart (Bill Hader) wird zunehmend ratlos, was er tun und wie es weitergehen soll. Denn Conor ist nur damit beschäftigt, den Scherbenhaufen seiner großen Liebe einzusammeln und Eleanor nachzulaufen, die er nicht mehr versteht, nicht ihren Versuch, sich das Leben zu nehmen, nicht die Radikalität, mit der sie sich abschottet von ihm. James McAvoy ("Der letzte König von Schottland", "Abbitte", "X-Men: Erste Entscheidung") verkörpert Conor mit großer Natürlichkeit, impulsiv, liebevoll, verzweifelt, auf den wunden Knien seines Herzens. Eleanor dagegen ist bei einer wieder herausragenden Jessica Chastain ("The Help", "Tree of Life", "Zero Dark Thirty") ein Wesen wie auf einem anderen Stern, untröstlich und unnahbar zugleich.
"Es fühlt sich an, als seien wir im gleichen Raum kilometerweit voneinander entfernt", sagt Eleanor einmal. Sie ist verschlossen in sich selbst, das Unglück hat die Tür verriegelt, die die Liebe öffnete zu Conor und der Welt. "All the lonely people, where do they all come from?", fragt der berühmte Song "Eleanor Rigby" der Beatles, und die Antwort, die dieser Film gibt, ist klar: aus dem Verlust des Wir. Jenes glückliche Wir, das die beiden mit dem Sohn waren, lässt sich nie wieder einholen, ihre Liebe als Paar aber ist nicht gestorben. Doch sie müssen sie neu entdecken – indem sie verstehen, dass sie die gleiche Situation auf ihre subjektive Weise ganz unterschiedlich erleben und verarbeiten. Erst wenn Conor begreift, dass er ihr nicht nachrennen darf, kann sie, in einer schweigend beredten Schlussszene, hinter ihm herlaufen. Erst wenn Eleanor versteht, dass er nicht weniger leidet als sie, können die Wege wieder kürzer werden zwischen den beiden. Wenngleich sie erst einmal auf unterschiedliche Kontinente führen.
"Das Verschwinden der Eleanor Rigby" ist mit seinen poetischen Bildern zwischen Glühwürmchenleuchten und blauer Einsamkeit (Kamera: Chris Blauvelt), seinem ruhigen Atem und seiner großen Nähe zu den Protagonisten nicht ein depressiver Film über verwaiste Eltern, sondern ein subtiles Porträt der Liebe. Und ihres Herzschlags, der nicht wild und adrenalinberauscht sein muss wie nach einer überstanden Zechprellerei, um stark zu sein und lebendig.
– "Das Verschwinden der Eleanor Rigby" von Ned Benson läuft in Freiburg. (Ab 6) von Gabriele Schoder
Vor allem das ursprüngliche Projekt: Benson, aufgewachsen in New York und Absolvent der Columbia University, hat seinen ersten Langfilm in zwei Varianten gedreht. "The Disappearence of Eleanor Rigby: Her" und "The Disappearence of Eleanor Rigby: Him" erzählen die gleiche Geschichte einmal aus der Perspektive der Frau, einmal aus der ihres Mannes, und die Kinogänger in Amerika konnten sich aussuchen, welche sie zuerst sehen wollten. Die gleiche Geschichte? Nicht ganz. Die beiden erleben identische Situationen sehr unterschiedlich, bis hinein in die Wahrnehmung von Kleiderfarben oder Wetter, eine Binsenweisheit in jeder Zweierbeziehung, gerade in Krisen und Konflikten. Aber wann hat das je ein Regisseur so radikal inszeniert?
Das Trauma, das das Glück dieses Paares gesprengt hat und beide an verschiedenen Ufern stranden ließ, ist der Tod ihres kleinen Sohnes. Der Film deutet ihn mehrfach an, aber auserzählt wird er nicht – wann und wie der Junge gestorben ist oder gar, ob einer der beiden Schuld daran trüge, ist unwichtig, es geht darum, wie die Trauer ein Liebespaar voneinander entfremdet. In den deutschen Kinos laufen – leider – nicht "Her" und "Him", sondern ein dritter Film: "Them", so der Untertitel, zeigt beider Sicht aufs Leben nach dem Verlust. Ein vergleichsweise konventionelles Drama, sicher, aber eines, das auf so schmerzliche wie tröstliche Weise unter die Haut geht.
Nicht zuletzt dank brillanter Schauspielerleistungen. Fangen wir mit den Nebenrollen an: Isabelle Huppert und William Hurt als die Eltern Rigby, die sich bei einem Beatles-Konzert in Paris kennengelernt haben und die Tochter deshalb Eleanor nannten. Vielleicht ist die Mutter, Französin, ein wenig zu klischeehaft ans Weinglas geklammert, und der Psychologenvater zu professionell in seinem Verständnis, aber beide sind herzzerreißend im Bemühen, der Tochter wieder hineinzuhelfen ins Leben. Das gelingt am ehesten der Universitätsdozentin, die Viola Davis als herrlich erdige, ironische und dabei hochsensible Gefährtin gibt.
Auch Eleanors Mann Conor ist nicht ohne Beistand. Aber der Vater (Ciarán Hinds) weiß nicht, ob und wie er ihm seine Liebe zeigen darf, und auch der beste Freund Stuart (Bill Hader) wird zunehmend ratlos, was er tun und wie es weitergehen soll. Denn Conor ist nur damit beschäftigt, den Scherbenhaufen seiner großen Liebe einzusammeln und Eleanor nachzulaufen, die er nicht mehr versteht, nicht ihren Versuch, sich das Leben zu nehmen, nicht die Radikalität, mit der sie sich abschottet von ihm. James McAvoy ("Der letzte König von Schottland", "Abbitte", "X-Men: Erste Entscheidung") verkörpert Conor mit großer Natürlichkeit, impulsiv, liebevoll, verzweifelt, auf den wunden Knien seines Herzens. Eleanor dagegen ist bei einer wieder herausragenden Jessica Chastain ("The Help", "Tree of Life", "Zero Dark Thirty") ein Wesen wie auf einem anderen Stern, untröstlich und unnahbar zugleich.
"Es fühlt sich an, als seien wir im gleichen Raum kilometerweit voneinander entfernt", sagt Eleanor einmal. Sie ist verschlossen in sich selbst, das Unglück hat die Tür verriegelt, die die Liebe öffnete zu Conor und der Welt. "All the lonely people, where do they all come from?", fragt der berühmte Song "Eleanor Rigby" der Beatles, und die Antwort, die dieser Film gibt, ist klar: aus dem Verlust des Wir. Jenes glückliche Wir, das die beiden mit dem Sohn waren, lässt sich nie wieder einholen, ihre Liebe als Paar aber ist nicht gestorben. Doch sie müssen sie neu entdecken – indem sie verstehen, dass sie die gleiche Situation auf ihre subjektive Weise ganz unterschiedlich erleben und verarbeiten. Erst wenn Conor begreift, dass er ihr nicht nachrennen darf, kann sie, in einer schweigend beredten Schlussszene, hinter ihm herlaufen. Erst wenn Eleanor versteht, dass er nicht weniger leidet als sie, können die Wege wieder kürzer werden zwischen den beiden. Wenngleich sie erst einmal auf unterschiedliche Kontinente führen.
"Das Verschwinden der Eleanor Rigby" ist mit seinen poetischen Bildern zwischen Glühwürmchenleuchten und blauer Einsamkeit (Kamera: Chris Blauvelt), seinem ruhigen Atem und seiner großen Nähe zu den Protagonisten nicht ein depressiver Film über verwaiste Eltern, sondern ein subtiles Porträt der Liebe. Und ihres Herzschlags, der nicht wild und adrenalinberauscht sein muss wie nach einer überstanden Zechprellerei, um stark zu sein und lebendig.
– "Das Verschwinden der Eleanor Rigby" von Ned Benson läuft in Freiburg. (Ab 6) von Gabriele Schoder
am
Fr, 28. November 2014